Publikationen Ihres Rechtsanwalts in Düsseldorf
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über alle Publikationen von Herrn Dr. jur. Scholzen.
Fachjournalistische Arbeit
Neben meiner anwaltlichen und wissenschaftlichen Tätigkeit bin ich seit Jahrzehnten freier Mitarbeiter für Fachzeitschriften, vor allem im Bereich Waffenrecht und Pferderecht. So schreibe ich immer wieder für die Magazine: Deutsches Waffenjournal, Der Büchsenmacher, Reiter-Revue International, Der Praktische Tierarzt, Rheinlands Reiter + Pferde, Paintball-Magazin. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl aus über 300 publizierten Artikeln, die Theorie und Praxis anschaulich verbinden.
Wissenschaftliche Arbeit
Ich war Mitautor des „Waffenrechtskommentar Hinze“, eines Standardwerks in der Fachliteratur.
Wenn die Gefahr lockt

Reiter-Revue International Heft 11/92, Seite 88 - 90
In der Praxis gibt es vielfältige Varianten und Möglichkeiten des Reitens fremder Pferde. Freizeitreiter mieten Pferde zum Ausritt; der Reitverein stellt seinen Mitgliedern Pferde zum Reiten in der Bahn und im Gelände zur Verfügung; der gewerbliche Pferdevermieter verdient u. a. mit dem Vermieten von Schulpferden sein Geld; bessere Reiter bereiten die Pferde der weniger guten Reiter gegen Entgelt oder auch aus eigenem Antrieb; umgekehrt leihen sich weniger gute Reiter gute Pferde aus. All diesen Varianten der täglichen Praxis ist es jedenfalls eigen, dass ein Reiter auf einem ihm nicht gehörigen Pferd sitzt und sich jedenfalls dem Risiko aussetzt, von diesem abgeworfen zu werden, was bekanntlich - mit verschiedener Wahrscheinlichkeit - weder der gute noch der schlechte Reiter mit letzter Sicherheit vermeiden kann.
Da Stürze vom Pferd nicht immer nur mit leichten Prellungen sondern teilweise auch mit schweren, ja irreparablen Verletzungen und Schäden verbunden sind, stellt sich meist erst nach einem Unfall für den Reiter die Frage, ob all diese Varianten auch über die Tierhalterhaftung abgedeckt sind oder überhaupt Tierhalterhaftung auch dem Reiter auf dem fremden Pferd zu Gute kommt. Anlass, dies alles noch einmal insgesamt zu überdenken, gibt ein neues Urteil des 6. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (BGH vom 09.06.1992 - VI ZR 49/91).
DAS PFERD ALS „LUXUSOBJEKT“
An sich ist die Tierhalterhaftung ein gewisser Sonderfall in unserer Rechtsordnung. Die Haftung hieraus hängt nicht von einem Verschulden ab, sondern stellt den Tatbestand der Gefährdungshaftung dar, der ansonsten auch im Straßenverkehrsrecht gilt. Der Grundgedanke der in § 833 BGB normierten Tierhalterhaftung liegt darin, dass unbeteiligte Dritte die von einem zu „Luxuszwecken“ gehaltenen Reitpferd ausgehende Gefährdung nicht ersatzlos sollen hinnehmen müssen. Der Bundesgerichtshof hat schon vor vielen Jahren eine Haftungsausdehnung auch auf den Reiter, der durch das von ihm gerittene Pferd zu Schaden kommt, vorgenommen. Dieser Schutz kann allerdings nicht grenzenlos sein, so dass die Rechtsprechung in der Folge bestimmte Einschränkungen erarbeitet hat.
Ein wesentlicher Grundsatz, der eine Haftung des Tierhalters ausschließt, ist der des „Handelns auf eigene Gefahr“. Dieser greift dann ein, wenn - ähnlich wie bei anderen gefährlichen Sportarten - der Reiter sich mit der Übernahme des Pferdes einer besonderen Gefahr ausgesetzt hat, die über die sonst mit dem Reiten verbundenen Risiken hinaus geht. Dies wird beispielsweise von der Rechtsprechung angenommen, wenn das Pferd erkennbar böswillig oder noch nicht zugeritten war oder wenn der Reiter an einem Turnier oder an einer Reitjagd teilnimmt.(...)
Tierarzthaftung und Pferdekauf

Der praktische Tierarzt, Heft 8/1993, Seite 726 - 728
Das wirtschaftliche Risiko bei dem Kauf eines teuren Sportpferdes unter Berücksichtigung des engen Kataloges der sechs Hauptgewährsmängel in Verbindung mit den extrem kurzen Gewährleistungs- und Verjährungsfristen, durch die die Rechte des Pferdekäufers in einer Weise reduziert werden, die das Ausweichen auf andere Regelungsmöglichkeiten geradezu herausfordert, hat dazu geführt, dass in der Praxis kaum noch ein Pferdekauf zustande kommt, bei dem nicht gleichzeitig die Einschaltung eines Tierarztes erfolgt.
Das mit jeder Kaufentscheidung verbundene Risiko wird versucht auf den Tierarzt abzuwälzen durch Beauftragung einer möglichst umfassenden tierärztlichen Untersuchung. Das dabei denkbare Fehlgutachten des Tierarztes im Verhältnis der Vertragsbeziehungen zum Auftraggeber selbst ist juristisch problemlos über die Vorschriften des Delikts- bzw. Vertragsrechtes zu lösen. Nicht eindeutig erklärt in diesem Zusammenhang war bisher die Konstellation, inwieweit die Ankaufs-/Verkaufsuntersuchung auch einen Dritten mit einbeziehen kann, d. h. ob der Tierarzt trotz der Erstellung der Untersuchung im Auftrage des Verkäufers auch dem Käufer des Pferdes bei einem Fehler im Rahmen der Verkaufsuntersuchung gegenüber haftet.
ALLGEMEINE ANSPRUCHSGRUNDLAGEN
Denkbare Anspruchsgrundlagen aus dem Gesetz sind die deliktische Haftung gem. §§ 823 ff. BGB und die vertragliche Haftung. Während man die deliktische Haftung an sich vernachlässigen kann, da sie nur dann vorliegt, wenn der Tierarzt eine unerlaubte Handlung begeht, also schuldhaft und widerrechtlich im Falle einer Behandlung eines Pferdes dieses schädigt und damit das Eigentum des Halters verletzt, ist das Hauptaugenmerk auf die vertragliche Haftung zu legen. Durch die Entgegennahme eines Auftrages zur Behandlung eines Pferdes verpflichtet sich der Tierarzt zum Einsatz seiner Kenntnisse und seiner Arbeitskraft sowie zur Durchführung aller Maßnahmen nach den Regeln der tierärztlichen Kunst. Teils werden die Verträge juristisch als Dienstverträge, teils auch als Werkverträge angesehen, mit den jeweils unterschiedlichen hieraus abzuleitenden Rechtsfolgen im Fall einer Störung der vertraglichen Leistungsbeziehungen bzw. der Schlechterfüllung der vertraglichen Pflichten und der unterschiedlichen Verjährungsregelung. Dabei ist nach herrschender Rechtsauffassung der Vertrag über die Durchführung einer Ankaufsuntersuchung als Werkvertrag einzuordnen. Dies heißt, dass der Tierarzt nicht nur den Einsatz seiner Arbeitskraft und seines tiermedizinischen Wissens schuldet; er hat vielmehr ein richtiges und zutreffendes Gutachten über die von ihm erhobenen Befunde und deren prognostische Einschätzung zu erstellen. Bei Fehlerhaftigkeit des Gutachtens haftet er auf Schadenersatz.
PROBLEMSTELLUNG
Die Frage, ob ein Verkäufer eines Pferdes den Käufer auf Wandlung bzw. Schadenersatz haftet, wenn er eine tierärztliche Untersuchung in Auftrag gibt und den Käufer ein darüber ausgestelltes fehlerhaftes Attest eines Tierarztes aushändigt, das die Gesundheit des Pferdes bescheinigt, ist in der Rechtsprechung nicht eindeutig abgeklärt. Die Gerichte sind teils dazu übergegangen, eine solche tierärztliche Bescheinigung dem Verkäufer als Eigenschaftszusicherung im Sinne des § 492 BGB zuzurechnen, andere Gerichte allerdings haben diese weitgehende Rechtsfolge nicht gezogen. (...)
Pferde im Einsatz in Förderung und Therapie - Luxustiere oder Nutztiere?
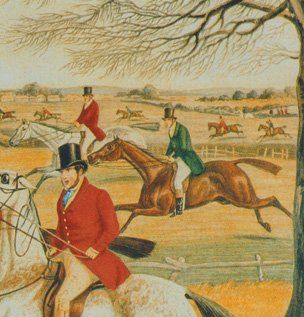
Mensch und Pferd International, Heft 4/2009, Seite 189 - 193
In der Praxis gibt es vielfältige Varianten und Möglichkeiten der Nutzung fremder Pferde. So mieten Freizeitreiter Pferde zum Ausritt, der Reitverein stellt seinen Mitgliedern Pferde zum Reiten in der Bahn und im Gelände zur Verfügung, der gewerbliche Pferdevermieter verdient u. a. mit dem Vermieten von Schulpferden sein Geld, bessere Reiter bereiten die Pferde der weniger guten Reiter gegen Entgelt oder auch aus eigenem Antrieb. Vereine leihen auch Pferde von Einstallern aus, um diese im Rahmen der Ausbildung ihrer Mitglieder zu nutzen, und dies in allen Sparten wie Dressur, Springen, Voltigieren, aber auch im Bereich Förderung und Therapie mit dem Pferd. Zwei große Teilbereiche sind hier im Hinblick auf die auftretende Haftung bei Unfällen im Zusammenhang mit dem Pferd zu unterscheiden. Dies ist zum einen die Tierhalterhaftung für „Luxustiere“, davon zu unterscheiden ist die Haftungslage, wenn die Pferde als Nutztiere gehalten werden. Zwei weitere Rechtsbegriffe, auf die eingegangen werden soll, sind die des Tierhalters im Rechtssinne und des Tierhüters.
TIERHALTERHAFTUNG FÜR „LUXUSTIERE“!
Die Tierhalterhaftung ist nach der Ausgestaltung des § 833 S. 1 BGB eine reine Gefährdungshaftung, d. h., dass jemand, der Pferde nicht zum Erwerb hält, sondern als Luxustier, verschuldensunabhängig haftet. Wer dagegen ein Pferd als Nutztier hält, kann dieser Haftung entgegen, wenn er den sogenannten Entlastungsbeweis führt. Als Nutztierhalter haftet er nämlich nur für vermutetes Verschulden. Gleiches gilt für die Haftung des Tierhüters. Die entsprechende Rechtsvorschrift enthält § 833 BGB. Grund für die verschuldensunabhängige Tierhalterhaftung ist die besondere Gefährlichkeit, die von Tieren aufgrund ihres unberechenbaren, willkürlichen Verhaltens ausgeht. Daher hat der Gesetzgeber festgelegt, dass derjenige, der ein solches Tier hält, dann, wenn es sich um ein Luxustier handelt, völlig unabhängig von jeglichem eigenen Verschulden haftet.
EIN BEISPIELSFALL
Beate B. war Hobbyreiterin. Sie lieh sich von Klara C. deren Pferd aus, weil ihr eigenes Pferd nicht einsatzfähig war. Der als faul bekannte Wallach reagierte nicht auf die treibenden Hilfen von Beate B. Im Rahmen eines Reitunterrichtes forderte der Reitlehrer sie auf, die Gerte zum Zwecke des Angaloppierens zu nutzen. Nach einem Klaps mit der Gerte buckelte der Wallach und warf Beate B. ab, die sich bei dem Sturz erhebliche Verletzungen zuzog. Sie verlangte Schadenersatz und Schmerzensgeld von der Pferdehalterin. Die in Anspruch genommene Tierhalterin haftete grundsätzlich, da sich der Schaden durch ein willkürliches Verhalten ihres Pferdes, nämlich durch das Buckeln, das Anlass für den Sturz war, verwirklicht hatte. Sie wandte allerdings ein, die Reiterin habe das Pferd aus eigenem Antrieb reiten wollen, sie habe also auf eigene Gefahr gehandelt oder hieraus habe sich ein stillschweigender Haftungsausschluss ergeben. Dem widersprach der Bundesgerichtshof. Er gab eindeutig zu verstehen, dass ein Pferdehalter auch dann haftet, wenn er sein Pferd aus reiner Gefälligkeit einem anderen überlässt und dieser durch das Pferd zu Schaden kommt.
HAFTUNG DES NUTZTIERHALTERS
Anders wäre es im Beispielsfall gewesen, wenn dieses Pferd der Berufs- oder Erwerbstätigkeit eines Halters gedient hätte. Zwar wäre dann auch die Reiterin zu Schaden gekommen, der Erwerbstierhalter/Nutztierhalter kann sich jedoch entlasten, wenn er nachweisen kann, dass er die erforderliche Sorgfalt bei der Beaufsichtigung des Tieres beobachtet hat oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden wäre. (...)
Heissbrand bei Pferden: Kein Verstoß gegen Tierschutzgesetz
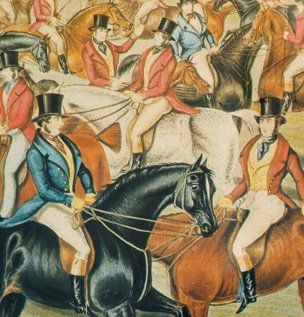
Rheinlands Reiter und Pferde, Heft 12/1995, Seite 81, 82
Nicht erst seitdem der Gesetzgeber die Rechtsstellung des Tieres als Sache aufgehoben hat und dem Tier auch rechtlich eine eigene Persönlichkeit zugeordnet hat, sondern auch seitdem der Umfang des Menschen mit dem Tier in zunehmendem Maße kritischer gesehen wird, stellte sich kürzlich die Frage, ob auch der Heißbrand bei Pferde nicht nur nicht erforderlich sondern möglicherweise sogar tierschutzwidrig ist. Wir erinnern uns sicher alle noch an die im Jahre 1990 in den Medien in breitem Umfang ausgetragene Diskussion über die sogenannte „Barr-Affäre“. Presse, Funk und Fernsehen nahmen sich dieser Problematik, die mit dem Namen von Paul Schockemöhle eng verbunden war, in allen denkbaren Varianten an. Nun traf es - wie in der Tagespresse berichtet wurde - kürzlich den Pferdezuchtverband Baden-Württemberg. Die Staatsanwaltschaft Offenburg hatte einen Durchsuchungsbeschluss zur Durchsuchung der Räumlichkeit dieses Pferdezuchtverbandes und zum Zwecke der Beschlagnahme von schriftlichen Unterlagen beantragt, mit dem Hinweis, im Rahmen dieses Zuchtverbandes werde der Heißbrand von Pferden durchgeführt. Dies stelle eine quälerische Misshandlung im Sinne des § 17 Nr. 2 b Tierschutzgesetz dar. Zu diesen Ermittlungen kam es, weil das Amtsgericht Kehl mit einem Beschluss vom 02. 04. 1994 das fachgerechte Anbringen eines Kennzeichens auf dem Schenkel eines Pferdes mittels eines Brenneisens als quälerische Misshandlung im Sinne des § 17 Nr. 2 b Tierschutzgesetz bezeichnet hatte und angeregt hatte, das Ermittlungsverfahren auszudehnen auf den Pferdezuchtverband. Um zu überprüfen, ob der Heißbrand tatsächlich gegen das Tierschutzgesetz verstößt, ist zunächst ein Blick auf die bereits genannte Vorschrift erforderlich sowie auf Sinn und Zweck des Tierschutzgesetzes.
DAS TIERSCHUTZGESETZ
Das Tierschutzgesetz enthält eine einleitende Vorschrift, wonach der Zweck dieses Gesetzes darin besteht, „aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“. Dieser Leitsatz des Tierschutzgesetzes ist allerdings im Bereich der Strafsanktionen nicht in vollem Umfang verwirklicht, denn dort sind nur ganz spezielle Handlungen genannt, die mit Strafe belegt sind, wie nachstehend noch ausgeführt wird. Gleiches kann dann auch für § 2 TschG gesagt werden, der eine allgemeine artgemäße Haltung von Tieren postuliert, jedoch nur in speziellen Ausgestaltungen wiederum ein Verstoß hiergegen als strafbare Handlung oder Ordnungswidrigkeit geahndet wird. Diese grundsätzlichen Vorschriften des Tierschutzgesetzes sind wohl eher als Aufforderung an die staatlichen Behörden zu verstehen, Verstößen, selbst wenn sie nicht strafbare Handlungen darstellen, vorzubeugen, etwa durch Untersagung der Haltung der Tiere in diesen bestimmten Fällen. (...)
Rechtsstellung des Pferdes und Schadensersatz

Reiter-Revue International Heft 11/92, Seite 88 - 90
Im Jahre 1990 hat der Gesetzgeber das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung des Tieres im Bürgerlichen Recht in Kraft gesetzt. Innerhalb des Gesetzes sind wesentliche Änderungen in Bezug auf die Herausnahme des Tieres aus dem Sachbegriff. Hiermit wurde eine grundsätzliche Kehrtwendung in der Rechtsentwicklung beschritten, denn die seit über 100 Jahren geltende Einordnung von Tieren in rechtlicher Hinsicht als Sache ist aufgehoben worden, und Tieren ist juristisch eine eigene Rechtsstellung als „Mitgeschöpfe“ eingeräumt worden. Sie sind nicht mehr leblose Sachen, sondern Lebewesen, die unter dem besonderen Schutz unterschiedlicher Gesetze stehen, wenn man etwa an das Tierschutzgesetz denkt. Für die Praxis ergeben sich hier zwei wichtige Änderungen und Erweiterungen. Zum einen wurde § 251 Abs. 2 BGB(Umfang des Schadenersatzes) geändert, zum anderen wurde ein Pfändungsverbot für Tiere bei Geldforderungen geschaffen. Praktisch besonders wichtig scheint die Erweiterung des Schadenersatzrechts, wie an dem nachfolgend geschilderten Beispielsfall dargelegt werden soll.
DER FALL
Ein Reiter, der jahrelang mit Genehmigung des Halters des Pferdes dessen Pferd geritten hatte, machte sich das Pferd eines Tages zu einem Austritt fertig und ritt in das an den Reiterhof angrenzende Gelände. Ihm war bewusst, dass das Pferd im Gelände zum Durchgehen neigte und ein Verbot des Pferdehalters bestand, das Pferd anders als in der Reithalle bzw. auf dem eingegrenzten Reitplatz, insbesondere nicht im Gelände zu reiten. Er verstieß gegen dieses Verbot. Das Pferd ging durch, überschlug sich und blieb schwer verletzt liegen. Die in der Folge aufgewendeten Tierarztkosten überstiegen den Wert des Pferdes um ungefähr 100 %. Am Ende der Heilbehandlung musste das Pferd dennoch eingeschläfert werden. Der Pferdewert betrug ca. 5.000,00 DM, die aufgewendeten Tierarztkosten ca. 12.000,00 DM. Der Halter verlangt nun vom Reiter Schadenersatz in Höhe der Gesamtsumme von 17.000,00 DM.
RECHTSGRUNDLAGE
Die grundsätzliche Haftung des Reiters, der verbotswidrig das Pferd im Gelände geritten hat und damit kausal die Verletzung des Pferdes, die anschließenden Tierbehandlungskosten und die Tötung verursacht hat, ist nicht zu bestreiten. Lediglich hinsichtlich der Höhe des Schadens ergaben sich Probleme, weil der Reiter einwandte, der Halter hätte das Pferd nicht unverhältnismäßig lange behandeln lassen dürfen, keinesfalls den Wert des Pferdes übersteigende Behandlungskosten aufwenden dürfen. Hier ist zunächst ein Blick auf die Vorschrift des § 251 Abs. 2 BGB erforderlich. Diese Vorschrift regelt allgemein Schadenersatzfragen unter Berücksichtigung der Unverhältnismäßigkeit. Durch die oben erwähnte gesetzliche Änderung lautet diese Vorschrift nunmehr: „Die aus der Heilbehandlung eines verletzten Tieres entstandenen Aufwendungen sind nicht bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie dessen Wert erheblich übersteigen“. Das Schadenersatzrecht des BGB ist grundsätzlich die Naturalrestitution. Jedoch kann der Gläubiger, wenn er wegen Beschädigung einer Sache Schadenersatz fordern kann, auch statt der Wiederherstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. Bis zu der oben angesprochenen gesetzlichen Änderung sah § 251 BGB eine Beschränkung vor, wenn die Wiederherstellung der beschädigten Sache nur mit unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich war. (...)
Erste Erfahrungen mit dem neuen Pferdekaufrecht

Rheinlands Reiter und Pferde, Heft 11/2003, Seite 92
Seit Januar 2002 plagen sich Käufer, Verkäufer und Tierärzte mit dem neuen Pferdekaufrecht. Es herrscht vielfach Verwirrung und Unkenntnis. Rechtsurteile liegen so gut wie nicht vor, was an der normalen Laufzeit der Rechtsfindung liegt. Viele potentielle Kläger oder Beklagte derartiger Rechtsstreite suchen lieber ihr Heil in der außergerichtlichen Einigung. Es kommt hinzu, dass die neue Situation auch teilweise verwirrend in den Medien dargestellt wird und dadurch falsche Vorstellungen geweckt werden. Hier ist nicht der Platz, die Neuerungen nochmals darzustellen. Nur soviel sei gesagt: jeder, ob Käufer oder Verkäufer sollte darauf achten, dass ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen wird, um festzulegen, welche Probleme später reklamiert werden können und welche Beschaffenheit des Pferdes als vereinbart gilt sowie welche Haftungseinschränkungen gemacht werden. Dies bedeutet zusammengefasst, dass nach dem neuen Recht ein Pferd nicht mehr gewandelt oder der Kaufpreis gemindert werden kann, wenn es entweder die Beschaffenheit hat, die die Vertragsparteien beim Kauf vereinbart haben oder wenn es allgemein für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung (Springen, Dressur, Gelände etc.) geeignet ist. Ist zwischen den Parteien allerdings nichts vereinbart, muss das Pferd die Beschaffenheit aufweisen, wie sie bei Tieren gleicher Art üblich ist. Ganz wesentlich ist auch, dass die Mängel, die später behauptet werden, um einen Umtausch oder eine Minderung herbeizuführen, bereits bei der Übergabe, also zum Zeitpunkt des Kaufes bestanden haben müssen. Sie dürfen darüber hinaus dem Käufer nicht bekannt gewesen sein. Welche Möglichkeiten der Käufer hat, wenn er feststellt, dass diese Voraussetzungen vorliegen und er dann seine Rechte geltend machen will, erfährt man durch einen Blick ins Gesetz. Es bleibt grundsätzlich bei Weigerung des Verkäufers, das Pferd zurückzunehmen oder den Kaufpreis zu mindern, die Möglichkeit einer Klage auf Wandlung bzw. Minderung. Dieser Weg ist nicht immer der beste, schon gar nicht der schnellste. Erst recht ist er nicht der preiswerteste. Wenn man von einem Kaufpreis von 5.000,00 € als Beispiel ausgehen will, hat derjenige, der den Prozess verliert, später mit Kosten in Höhe von ca. 3.000,00 € zu rechnen. Diese setzen sich aus Anwaltskosten beider Parteien, Gerichtskosten und Sachverständigengebühren für die Einholung eines fast immer erforderlich werdenden Gutachtens zusammen. Ein anderer Weg, der vermehrt Platz greift, ist der schnellere und kostengünstigere Weg der Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens. (...)
Anlasslos
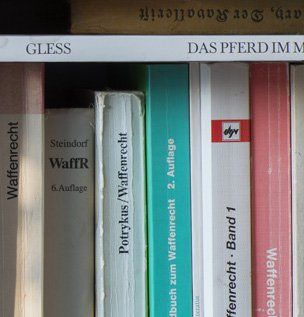
Im Rahmen der geplanten gesetzlichen Abänderungen des Waffengesetzes war die Forderung nach einer anlasslosen Begehung von Wohnungen bei Waffenbesitzern zu hören. Diese Forderung soll an dieser Stelle weder auf ihren Sinngehalt geprüft werden, noch darauf, ob sie überhaupt eine Amoktat wie die des Täters von Winnenden hätte verhindern können.
Diesem Beitrag soll vielmehr die juristische Durchsetzbarkeit einer anlasslosen Begehung von Wohnungen bei Waffenbesitzern zugrunde gelegt werden, wobei kurz nach Fertigstellung dieses Beitrages bereits die Befürworter einer solchen anlasslosen Begehung erhebliche formale Einschränkungen hinnehmen mussten. Schon bei der Änderung des Waffengesetzes im Jahre 2003 wurde im Zusammenhang mit gesetzlich verlangter sicherer Verwahrung von Schusswaffen diskutiert, welche Sicherheitsstandards Waffenräume aufweisen müssen. Die Vorgabe ist zunächst die Unterbringung in bestimmten klassifizierten Schränken und Tresoren einer bestimmten Anzahl von Kurz- oder Langwaffen. Bei Waffensammlern jedoch würde dies zu technisch und finanziell nicht lösbaren Problemen führen, so dass der Gesetzgeber eine flexible Anpassung an die Gegebenheiten und das Gefahrenpotential vor Ort in § 13 der Waffengesetzverordnung vorgesehen hat. Die Ausnahmen, die § 13 Abs. 5, 7 und 8 der Verordnung vorsehen, sind bei vernünftiger Auslegung geeignet, sowohl den Interessen von Sammlern und anderen Waffenbesitzern Rechnung zu tragen, als auch den Belangen der öffentlichen Sicherheit.
BEGEHUNGSRECHTE
Damit eine derartige Aufbewahrung nicht nur eine Forderung bleibt, sondern auch tatsächlich erfüllt wird, wurden schon durch die gesetzliche Änderung des Waffengesetzes im Jahre 2003 Grundrechte eingeschränkt, nämlich konkret die Unverletzlichkeit der Wohnung aus Artikel 13 Grundgesetz (GG). Dieser lautet:
Artikel 13 (Unverletzlichkeit der Wohnung)
Die Wohnung ist unverletzlich. Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden. Eingriffe und Beschränkungen dürfen im Übrigen nur zur Abwehr einer Gemeingefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, aufgrund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorgenommen werden“. Schon nach früherem Recht war es möglich, Gewerbetreibende ohne Vorankündigung in ihren Gewerberäumen zu überprüfen. Dies ist auch bei Änderung des Waffengesetzes im Jahre 2003 unverändert in das Gesetz übernommen worden. Erweitert wurde diese Regelung aber auch auf die privaten Waffenbesitzer. Während ansonsten die Begehung und das Betreten einer Wohnung gegen den Willen des Hausrechtsinhabers nur mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss grundsätzlich möglich war oder eine solche Begehung nur bei Gefahr im Verzuge geduldet werden musste, sind seit 2003 anderweitige Kriterien geschaffen worden. Die für die Durchführung des Waffengesetzes zuständigen Verwaltungsbehörden und nicht etwa die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, können auch ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung eines Waffenbesitzers gelangen, wenn der Verdacht besteht, dass die Waffen nicht korrekt verwahrt werden. Die Einschränkung des Grundrechts bezieht sich allerdings nur auf die Aufbewahrung und deren korrekte Verwirklichung, nicht auf den Tatbestand des illegalen Waffenbesitzes. Hier ist wiederum ein richterlicher Hausdurchsuchungsbeschluss erforderlich. In § 36 Abs. 3 WaffG ist hierzu eingefügt worden, dass die Behörde bei begründeten Zweifeln an einer sicheren Aufbewahrung verlangen kann, dass der Besitzer von Schusswaffen den Behördenvertretern zur Überprüfung der sicheren Aufbewahrung Zutritt zum Ort der Aufbewahrung gewährt. (...)
Wirkungslos

Deutsches Waffenjournal, Heft 12/2010, Seite 80 f.
Amokläufe, bei denen als Tatmittel eine Schusswaffe zum Einsatz kam, führten in der Vergangenheit regelmäßig dazu, dass ein Verbot des Waffenbesitzes in Privathand gefordert wurde - zumindest aber eine Einschränkung hinsichtlich bestimmter Arten von Schusswaffen.
Nach weiter zurückliegenden Taten wie in der Columbine Highschool in den Vereinigten Staaten von Amerika oder dem Dunblane-Attentat in England erfolgten ebenso derartige Reaktionen und Forderungen wie nach den jüngsten Attentaten in Deutschland - Winnenden und Lörrach. Dabei zeigte gerade die Amoktat in Lörrach, dass zwar eine Schusswaffe als Tatmittel verwendet wurde, aber auch viel einfachere, jederzeit zugängliche Haushaltsgegenstände wie Messer und Nitroverdünnung zum Einsatz kamen. Völlig außer Acht gelassen wird, dass bei solchen Taten nicht etwa ausschließlich legal besessene Waffen zum Einsatz kamen, was schon das beliebte Argument des Waffenverbotes in die Irre gehen lässt. Hierzu erstellte Statistiken und Auswertungen des Beweismaterials etwa im Rahmen der Dunblane-Untersuchung, passen vom Ergebnis her nicht ins Bild und werden schlicht negiert. Dort ist die These eindeutig widerlegt, dass eine starke Beziehung zwischen Verfügbarkeit von Schusswaffen und deren Gebrauch bei kriminellen Vergehen bestehe. Schon im Jahre 1997 hat der Autor an dieser Stelle unter Beifügung zahlreicher Statistiken die entsprechende Theorie widerlegt, wonach die Verfügbarkeit von Schusswaffen in Privathand nicht Ursache sein kann. Das immer wieder gehörte Argument, dass der Abzug den Finger zieht und nicht umgekehrt, ist statistisch nicht belegbar.
ÜBERBLICK UND VERGLEICHE MIT ANDEREN LÄNDERN
Bei oberflächlicher Betrachtungsweise könnte man der Ansicht sein, dass ein strenges Gesetz Straftaten reduziert und zwar allgemein und speziell in Bezug auf das Waffengesetz. Diesem Argument folgte man auch in den späten 1960-er Jahren in den Vereinigten Staaten, also sowohl die Mordraten wie der Markt für Schusswaffen in schnellem Tempo zunahmen. Danach folgten sie in den folgenden Jahren einem unregelmäßigen Muster von Auf und Ab, obwohl sich der Bestand der Faustfeuerwaffen in Amerika von damals 40 Millionen auf über 82 Millionen verdoppelte. Die Zahl der Mordrate blieb jedoch gleich hoch. Auch die Ausdehnung auf anderweitige Straftaten wie Raub, schwere Körperverletzung, Vergewaltigung oder Diebstahl bei Einbeziehung von Schusswaffen änderte nichts an diesem Ergebnis. Wie schon Ernst Dobler in seiner Dissertation an der Universität Freiburg ausführte, ist die Erkenntnis, dass eine Verringerung der vorhandenen Schusswaffen nicht notwendig eine Verringerung der Schusswaffendelikte zur Folge hat, auch auf Deutschland anwendbar. Er führt sogar aus, dass es denkbar sei, dass eine Erhöhung des legalen privaten Schusswaffenbestandes sich dämpfend auf Delikte der Gewalt- und Eigentumskriminalität auswirken könnte. (...)
Wer darf?

Deutsches Waffenjournal, Heft 5/2011, Seite 96 f.
Die nachstehenden Ausführungen befassen sich mit den Voraussetzungen des Sachkundenachweises für Waffensammler und mit dem neuartigen Begriff, der nicht im Waffengesetz enthalten ist, aber durch die Rechtsprechung geschaffen wurde.
Dabei handelt es sich um die Sammlerbefähigung. Die gesetzliche Sachkunde und die Befähigung eines Sammlers werden immer wieder durch Erlaubnisbehörden vermengt. Schon vor ca. 10 Jahren musste hierzu eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ergehen, auf die weiter unten im Rahmen eines Beispielfalles noch näher eingegangen wird.
SACHKUNDE
Nach § 7 Abs. 1 WaffG gilt der Nachweis der Sachkunde als erbracht, wenn eine Prüfung vor der zuständigen Behörde bestanden wurde oder die Sachkunde durch eine Tätigkeit oder Ausbildung nachgewiesen wird. Die spezielle Anforderung an den Umfang der Prüfung und das Verfahren sowie über den anderweitigen Nachweis der Sachkunde ist in den §§ 1 bis 3 WaffG-Verordnung geregelt. Die Grundnorm des § 4 Abs. 1 Nr. 3 WaffG spricht dabei nicht generell von Sachkunde, sondern von der „erforderlichen Sachkunde“. Bestimmte Gruppen von Waffenbesitzern benötigen nicht unbedingt Kenntnisse über alle Arten von Schusswaffen. So benötigt ein Wassersportler allenfalls Kenntnisse über spezielle Signalpistolen. Deshalb kommt es auch bei dem Nachweis der Sachkunde auf die zugrunde liegende Bedürfnisart an (Jäger/Sportschütze/Sammler/Bewachungsunternehmer etc.). Dies soll aber nicht heißen, dass etwa die abgelegte Jägerprüfung auch eine ausreichende Sachkunde für den Erwerb von Sportwaffen oder Sammlerwaffen enthält. Die Differenzierung gibt vielmehr dem Antragsteller im Rahmen seines Bedürfnisses die Möglichkeit, nur die Kenntnisse über Schusswaffen und Munitionsarten nachweisen zu müssen, die sich auf Waffen aus seinem Bedürfnisbereich beziehen. Die Anrechnung und der anderweitige Nachweis der Sachkunde, ohne die eingangs erwähnte Prüfung - die in der Praxis die Ausnahme darstellt -, sind wiederum festgelegt in § 3 Abs. 1 WaffG-Verordnung. Danach gilt die bestandene Jägerprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung ebenso als anderweitiger Nachweis der Sachkunde wie die bestandene Gesellenprüfung für das Büchsenmacherhandwerk oder der Nachweis der Fachkunde nach § 22 WaffG. Die Vorschrift spricht auch erworbene Kenntnisse aufgrund anderweitiger, insbesondere behördlicher oder staatlich anerkannter Ausbildung an, aber nur dann, sofern diese Ausbildung ihrer Art nach geeignet war, die für den Umgang mit der beantragten Waffe oder Munition erforderliche Sachkunde zu vermitteln (Ausbildung im Polizeidienst). Nicht gelten soll jedoch die Begünstigung des § 4 Abs. 7 WaffG-Verordnung für Soldaten (VGL. BR-Drs. 415/03 zu § 4). Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die Sachkunde auch durch Lehrgänge, welche staatlich anerkannt sein müssen, erworben werden kann (§ 3 Abs. 2 WaffG-Verordnung). Bei Waffensammlern wird jedoch die überwiegende Möglichkeit des Sachkundenachweises darin bestehen, dass der Sammelanfänger schon in anderer Weise Waffenbesitzer ist, nämlich etwa als Jäger oder Sportschütze. Dabei gilt auch die Abnahme einer Sachkundeprüfung in einem Schießsportverein für die Mitglieder im Rahmen eigener Prüfungsausschüsse als anderweitiger Nachweis (...)
Praxisferne
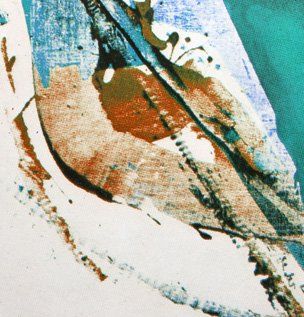
Deutsches Waffenjournal, Heft 7/2012, Seite 92
Schon mehrfach wurde im DWJ auf praxisferne, manchmal verwunderliche Verwaltungsgerichts- und Strafurteile hingewiesen, die ja in der Folge auch zu erheblichen Konsequenzen führen können.
So ist aus manch einem gesetzestreuen Waffenbesitzer oder Jäger dann schnell ein Straftäter geworden. Verantwortlich für solche fragwürdigen Urteile sind oft nicht nur die komplizierten rechtlichen Regelungen, sondern auch mangelndes Praxisverständnis, teils sogar Lebenserfahrung. Wenn dann noch der eigentliche Sinn des Gesetzes im Rahmen der Auslegung nicht hinreichend beachtet wird, sondern lediglich am Wortlaut argumentiert wird, kommt es zu solchen seltsamen Auswüchsen. Hierzu ein kurioses Beispiel:
Für das Führen einer Schusswaffe benötigt man bekanntlich einen Waffenschein. Da das Waffengesetz aber wesentliche Teile von Schusswaffen den Schusswaffen wiederum gleich stellt, würde es auch ausreichen, wenn man etwa einen Lauf, einen Verschluss oder eine Trommel zugriffsbereit - also nicht in einem verschlossenen Behältnis - bei sich führt. Denn logischerweise folgt aus der Gleichstellung der wesentlichen Teile mit der kompletten Schusswaffe auch bei reiner Orientierung am Wortlaut des Gesetzes eine Waffenscheinpflicht für derartige Teile. Eine Überlegung und Anwendung nach Sinn und Zweck des Gesetzes würde jedoch eine solche Rückfolgerung ausschließen. Wenn sich dann eine solche Urteilsauslegung, die in einem Urteil auch noch festgeschrieben ist, weiter ausdehnt und durch andere Verwaltungsgerichte ohne eine vorhergehende sorgfältige Prüfung übernommen wird, kann sehr schnell ein Trend entstehen, der das Gesetz in seiner Richtung konterkariert und salopp ausgedrückt, die Kirche nicht im Dorf lässt.
BEISPIELSFALL
In zwei Fällen, bei denen Jäger während der Ausübung der Jagd oder im Revier ihre mitgeführte geladene Kurzwaffe verloren hatten, wurden durch die zuständigen Verwaltungsbehörden Urteile von Verwaltungsgerichten herangezogen, ohne sich im Einzelnen mit den Urteilsgründen auseinander zu setzen und indem nur der Leitsatz des Urteils übernommen wurde. Bei dem einen Jäger war aus einem Holster, welches er am Gürtel trug, während einer Treibjagd aus unerklärlichen Gründen ein geladener Revolver heraus gefallen. Bei dem anderen Jäger befand sich ein geladener Revolver in einem Rucksack in einer Seitentasche, die nach oben hin mit dicken Wildlederhandschuhen zugestopft war. Auch bei diesem Jäger kam es zum Verlust der Waffe aus dem Rucksack. Beide Jäger meldeten pflichtbewusst unverzüglich den Verlust, was ihnen dann den Vorwurf einbrachte, mit den Waffen nicht ordnungsgemäß umgegangen zu sein und deshalb eine Variante der Regelunzuverlässigkeit nach § 5 Abs. 2 WaffG verursacht zu haben. Die Verwaltungsbehörden stützten sich dabei auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) der Stadt Lüneburg aus dem Jahre 2006, wo der Leitsatz geprägt wurde: „Zu den Pflichten eines Jägers gehört es, Schusswaffen erst dann zu laden, wenn mit ihrem bestimmungsmäßigen Gebrauch der Jagdausübung unmittelbar zu rechnen ist. Das gilt erst recht für eine Waffe, die nur dazu dient, angeschossenem Wild den Fangschuss zu geben“ (Aktenzeichen 8 ME 50/06) (...)
Ungeklärt

Deutsches Waffenjournal, Heft 8/2014, Seite 112
Der Fall kommt immer wieder vor: Ein Waffenbesitzer verstirbt, die Nachkommen wissen nun nicht, was mit den vererbten Waffen zu tun ist und oft wurden echte Schätze aus Unwissenheit vernichtet.
Die Rechtsprechung zum Thema Blockierpflicht ist jetzt um eine Facette reicher. Wie bereits mehrfach, auch an dieser Stelle, berichtet, ist die Blockierpflicht für Erbwaffen nach wie vor noch nicht höchstrichterlich entschieden worden. Zu dieser Problematik sind bisher leider in ihrer Aussage recht widersprüchliche Urteile des Verwaltungsgerichts Arnsberg und des Verwaltungsgerichts Köln ergangen. Strittig ist, ob von der im Jahre 2003 eingeführten Blockierpflicht für Erbwaffen auch die Erben von Schusswaffen betroffen sind, welche die Waffen bereits vor 2003 geerbt haben.
ALLGEMEINES
Das Erbrecht in Deutschland gibt ganz allgemein gesagt die Möglichkeit, auch über den Tod hinaus über vorhandenes Eigentum und Vermögen zu verfügen. Ein Erblasser hat also die Möglichkeit, durch Testament oder Erbvertrag eine sogenannte Letztwillige Verfügung zu treffen, um eine bestimmte Person (Erben) mit seinem Eigentum zu begünstigen. Wird kein Testament verfasst, greift die gesetzliche Erbfolge ein. Diese ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 1922 ff. BGB) geregelt. Während etwa Gegenstände wie Geld, Antiquitäten oder auch Grundstücke ohne besondere Berücksichtigung gesetzlicher Vorschriften vererbt werden können, sieht das Waffengesetz eine spezielle Erbenregelung vor.
REGELUNG IM WAFFENGESETZ
Das deutsche Waffengesetz regelt den Erwerb von Waffen im Wege der Erbfolge grundsätzlich dahin, dass der Erwerb von Schusswaffen von Todeswegen möglich ist (§ 20 WaffG). Dieses sogenannte „Erbenprivileg“ war mehrfach Gegenstand von Erörterung und Entscheidungen von Verwaltungsgerichten. Lange Jahre wurde durch die Verwaltung toleriert, dass auch nicht angemeldete Schusswaffen geerbt werden konnten und dass diese durch die Anmeldung des Erben in eine Waffenbesitzkarte eingetragen wurden. Dieser langjährigen Praxis machte eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 1999 allerdings ein Ende. Das Bundesverwaltungsgericht wies damals darauf hin, dass nur etwas geerbt werden könne, das auch im legitimen Besitz des Erblassers gewesen sei. Damit war der Weg, nicht angemeldete Schusswaffen über das Erbrecht zu legitimieren, abgeschnitten worden. Dies wiederum führt in der Praxis dazu, dass nicht angemeldete Schusswaffen aus dem Nachlass wahrscheinlich nicht mehr der Behörde zur Kenntnis gegeben werden und damit die Zahl der „im Volk“ befindlichen illegalen Schusswaffen vermehrt wird. Im Jahre 2003 wurde das Waffengesetz auch in diesem Punkte entsprechend geändert. Zunächst einmal wurde eine Klarstellung zwischen Erben und Vermächtnisnehmern vorgenommen. Durch die damals eingetroffene Neuregelung wurden der Vermächtnisnehmer und der durch eine Auflage Begünstigte in die für Erben geltende Regelung einbezogen. Im Rahmen der Gesetzesberatung war zunächst geplant, dem Erben einer Waffe nur einen befristeten Besitz für etwa ein Jahr unter gleichzeitigem Ausschluss der Benutzbarkeit der Schusswaffe durch ein Blockiersystem zu bewilligen. (...)
Euro-Gewährleistungsrecht

Der Büchsenmacher, Heft 6/1998
Erst kürzlich berichtete ich über eine neue Europa-Richtlinie zur Novelle des Garantiegesetzes. Der weitere Verlauf des Schicksals dieser Novelle zeigt, dass diese Richtlinie durch das Europäische Parlament weiterbetrieben wird.
Ziel der Richtlinie ist es, die als große Hindernisse bei grenzüberschreitenden Käufen im Binnenmarkt geltenden Gewährleistungsregel zu harmonisieren. Kurz zur Erinnerung:
Jeder Mitgliedsstaat in der EG hat seine eigenen Gewährleistungsrichtlinien. In Deutschland sind diese im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und haben zur Folge, dass bei Fehlern von Produkten der Erwerber dieser Produkte verschiedene Rechtsfolgen wählen kann. Zum einen ist dies die Wandlung, d. h. Rückgängigmachung des Kaufvertrages durch Rückgabe der gekauften Sache und Rückgewähr des Kaufpreises. Zum anderen ist dies auch die Möglichkeit der Minderung. Der Kaufgegenstand wird also nicht zurückgegeben, sondern nur der Kaufpreis anteilmäßig gemindert und dieser Anteil zurückgefordert. Ergänzend kommt hinzu noch eine Schadenersatzforderung, falls sich aus der mangelhaften Sache weitere Schäden im Vermögen des Käufers ergeben. Soweit die Gesetzeslage in Deutschland. Der Richtlinienvorschlag, der in seiner jetzigen Form eine Harmonisierung der bestehenden unterschiedlichen Gewährleistungsregeln anstrebt, war von Anfang an heftig umstritten. Die Verbrauchervereinigungen forderten einen stärkeren Schutz des Verbrauchers bei grenzüberschreitenden Kaufverträgen. Industrie und Vertreter von Handel und Handwerk äußerten große Bedenken und wiesen auf die enormen Folgekosten hin, die eine solche Richtlinie mit sich bringen würde. Hinzu kamen erhebliche juristische Bedenken rechtspolitischer Art bezüglich der europäischen Vereinheitlichung von Teil-Rechtsgebieten. Gerade das deutsche BGB hat wegen seiner klaren Struktur und der Beschränkung auf das Wesentliche auch nach jetzt über 100 Jahren immer noch unverändert Gültigkeit. Eine Teilangleichung von Rechtsgebieten in den Mitgliedsstaaten führt zu Nachteilen, weil diese geänderten Kompetenzbereiche nicht mit der Gliederung der Rechtsgebiete in den Mitgliedsstaaten übereinstimmen. Es entstehen juristische „Flickenteppiche“, die wiederum zu einer Rechtszersplitterung innerhalb des europäischen Raums führen werden. Die geplante Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf wird zur Schaffung eines Gewährleistungsrechts führen, das nicht in die Systematik des deutschen BGB passt. Demzufolge hat auch nach der ersten Lesung des Europäischen Parlaments die Bundesrepublik Deutschland den gesamten Richtlinienvorschlag abgelehnt. Allerdings reichen die deutschen Stimmen alleine nicht aus, um die Richtlinie zu verhindern. Der Rat ist nunmehr gehalten, den gemeinsamen Standpunkt zu verabschieden. Es bleibt zu hoffen, dass die Vertreter der deutschen Regierung sich dann weiterhin inhaltlich an den Verhandlungen beteiligen, um zumindest eine Verbesserung des Inhaltes der einzelnen Regelungen zu erreichen.
INHALTLICH GEPLANTE REGELUNGEN
Zunächst einmal wird ein neuer Fehlerbegriff geschaffen. Dieser Fehlerbegriff hebt die Unterscheidung zwischen offensichtlichen und versteckten Mangel auf. Ihr Wegfall soll eine Erleichterung nicht nur für den Verbraucher sondern auch für die Gerichte darstellen. Des Weiteren soll der Mängelbegriff sehr weit gefasst werden. Danach soll als Fehler einer Sache im Rechtssinne angesehen werden jede nicht vorhandene Übereinstimmung mit technischen Daten oder mit Zusagen oder Erwartungen, die vom Verkäufer oder in der Werbung geweckt wurden. Diese Ausweitung lässt erhebliche Nachteile für Handel und Industrie befürchten.
GARANTIEFRIST
Es soll europaweit eine Mindestgarantiefrist von zwei Jahren eingeführt werden. Hiermit wird eine deutliche Besserstellung des Käufers vorgesehen, wenn man bedenkt, dass die Gewährleistungsfristen in den Mitgliedsstaaten schwanken zwischen sechs Monaten und sechs Jahren (...)
Rechtliche Einordnung des Paintballspiels

Paintball-Magazin, Heft 4/06, Seite 30 - 33
In den letzten Jahren hat sich ausgehend von den U.S.A. auch in Europa der zunächst unter dem Namen Gotcha bezeichnete Paintball-Sport zunehmend auch in Deutschland durchgesetzt. Von Anfang an war dieser neue Sport Gegenstand polemischer Attacken in Deutschland. Vorschnell wurde die Ausübung dieser Sportart als „Killerspiel“ bezeichnet. Dabei setzten sich die Gegner des Sports weder mit der konkreten Spielpraxis auseinander noch mit der Tatsache, dass in anderen westlich geprägten Ländern der Welt dieser Sport nicht nur ohne Beanstandung betrieben wird, sondern häufig sogar öffentliche Anerkennung bis Förderung erreicht hat. Es dauerte seine Zeit, bis sich erstmals auch die Gerichte mit dem Paintball-Spiel befassen mussten. Während Anfang der 90-er Jahre dieser Sport ziemlich wertfrei in Abbruchgeländen, Wäldern und Kiesgruben betrieben wurde, was nicht selten Polizeieinsätze bis hin zu Sondereinsatzkommandos auslöste, weil besorgte Betrachter aufgrund der überwiegend in Tarnkleidung agierenden Spieler von Terroristengruppen oder Wehrsportgruppen ausgingen, wandelte sich später das Bild auch rein äußerlich hinsichtlich der Kleidung zur Verwendung von Trainingsanzügen in Neonfarben. Von Anfang an bestanden Schwierigkeiten, Gelände zu binden, wo derartige Wettkämpfe abgehalten werden konnten. Erklärlich, wenn man bedenkt, dass Ariale von der Größe zweier Fußballfelder im Regelfall benötigt werden. So boten sich insbesondere alte Fabrikgelände, Abbruchhäuser, aber auch private Waldstücke an. Je nachdem, wo die Ausübung des Paintball-Spiels erfolgt, werden die unterschiedlichsten gesetzlichen Vorschriften berührt. Besonders komplex ist in rechtlicher Hinsicht die Ausübung dieses Spiels in Waldgeländen. Hier werden Vorschriften des Naturschutzes berührt. Es stellen sich außerdem Fragen der gewerblichen Nutzung des Waldes, der grundsätzlich dem Erholung suchendem Publikum zur Verfügung stehen soll. Es ergeben sich auch baurechtliche Fragen, etwa wenn Waldstücke eingezäunt werden um zu verhindern, dass Dritte in das Spielgelände eindringen oder dass die verwendeten Farbkugeln das Spielgelände verlassen. Aufgrund der Komplexität der Rechtsmaterie ist in der Praxis kaum festzustellen, dass das Paintball-Spiel im Wald ausgeübt wird. Überwiegend werden Privatgelände ohne Waldbezug genutzt.
RECHTSBEREICHE
Zwei große Rechtskomplexe greifen bei der Ausübung des Paintball-Spiels ein. Dies ist zum einen das Waffenrecht, zum anderen auch der Bereich des Ordnungswidrigkeitenrechts sowie der Gewerbeordnung. Erst die verwendeten Farbmarkierer sind zunächst Schusswaffen im Sinne des Waffengesetzes. Sie fallen unter § 1 des WaffRNeuRegG vom 11. Oktober 2002. Danach sind Waffen Schusswaffen, also Gegenstände, die zum Angriff oder zur Verteidigung, zur Signalgebung, zur Jagd, zur Distanzinjektion, zur Markierung, zum Sport oder zum Spiel bestimmt sind und bei denen Geschosse durch einen Lauf getrieben werden (§ 1 WaffG i.V. mit Anlage 1 Abschnitt 1, Unterabschnitt 1, Rdnr. 1 ff.). Hinsichtlich des Erwerbs und Besitzes sieht das Waffengesetz eine Erleichterung vor, wenn es sich um Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen handelt, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, wenn den Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 Joule erteilt wird und die das Kennzeichen nach Anlage 1, Abbildung 1 zur Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung bestimmtes Zeichen tragen (F im Fünfeck). Dies ergibt sich aus Anlage 2, Abschnitt 2 Nr. 1.1. Voraussetzung ist für den Erwerb und Besitz lediglich das Alterserfordernis von 18 Jahren. Personen unter 18 Jahren, denen eine solche Waffe überlassen wird, begehen eine Ordnungswidrigkeit, die dann sowohl auf Seiten des Erwerbs wie des Überlassers vorliegt. Neben der Regelung hinsichtlich des Erwerbs und Besitzes dieser Waffen greift die Vorschrift über das Führen von Schusswaffen ein. (...)
Anlasslos
Wirkungslos
Wer darf?
Praxisferne
Ungeklärt
Euro-Gewährleistungsrecht
Oststraße 154,
40210 Düsseldorf
Powered by Sellwerk